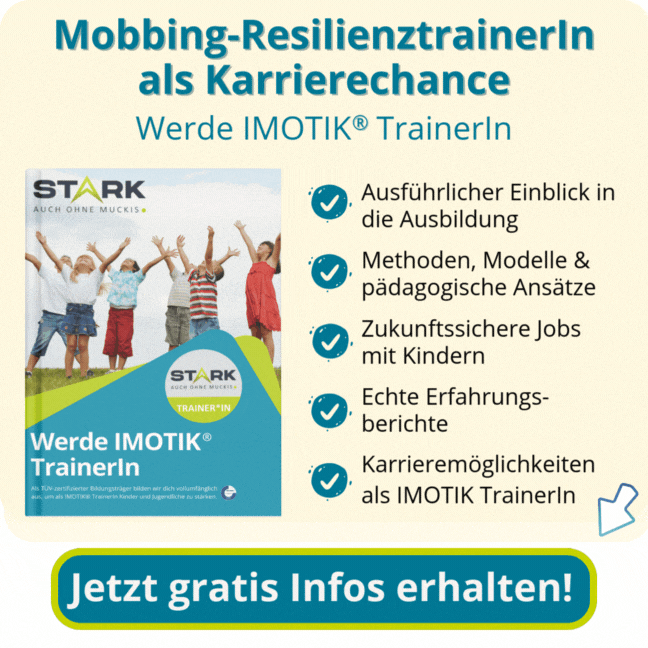Folgen von Mobbing: Erkennen, Verhindern und Überwinden




Den Begriff des Mobbings hören wir häufig und in unterschiedlichen Zusammenhängen. Er sollte allerdings achtsam und nicht verharmlosend verwendet werden.
Nicht bei jeder Auseinandersetzung handelt es sich um ein Mobbing-Geschehen. Dabei gibt es spezifische Merkmale zu beachten. Die Folgen können für die Betroffenen dramatisch sein.
Lies in unserem Artikel, woran du erkennen kannst, ob jemand gemobbt wird, wie die Folgen aussehen und welche Gegenkräfte wirken.
Was ist Mobbing?
Mobbing ist gezieltes und andauerndes aggressives Verhalten gegen einen oder mehrere Menschen. Die Dramatik, die die Opfer erleben, ist enorm. Das Geschehen kann Angst und Depressionen, innere Unruhe, Schlafprobleme, andauernde Nervosität oder soziale Isolation verursachen.
Es ist eine starke persönliche Belastung mit enormen Auswirkungen auf die psychische Gesundheit der Opfer. Kinder und Jugendliche, die Opfer geworden sind, haben oft ihr ganzes Leben lang an den Mobbing Folgen zu tragen.
Typische Kennzeichen für Mobbing
Beim Mobbing handelt sich um eine bewusste Form der regelmäßigen psychischen Gewalt, die gegen eine bestimmte Person gerichtet ist. Es geht nicht um einen einzelnen und ungeplant auftretenden Konflikt. Es ist ein dauerhaftes und zielgerichtetes aggressives Handeln.
Dieses Verhalten wird aggressiv und rechtswidrig gegen eine einzelne Person oder auch gegen eine Gruppe von bestimmten Personen gerichtet. Ziel ist es, die andere Person wiederholt und systematisch zu demütigen, zu diskriminieren oder zu verletzen. Oft gehören Herabwürdigungen und Beleidigungen dazu.
Auch bewusstes Vorenthalten von Informationen oder ungerechte Leistungsbewertungen sind bezeichnende Elemente. Möglich sind verschiedene Arten von Mobbing und Verletzungen, einschließlich körperlicher Gewalt. Sowohl Verleumdung, psychische Misshandlung, gezielte soziale Isolation und Cybermobbing können dazugehören.
Viele Menschen berichten von aggressiven Schikanen am Arbeitsplatz. Diese Form der psychischen Gewalt betrifft allerdings nicht nur Erwachsene: Auch Kinder und Jugendliche sind ihr ausgesetzt.
Orte des Geschehens sind häufig Schulen, Online-Communitys sowie andere soziale Kontexte. Überall, wo Menschen miteinander agieren, besteht die Gefahr von Schikane, im Freundeskreis genauso wie in der Familie.
Die Auswirkungen auf die Opfer können gravierend sein. Nicht selten treten als Folge psychische Probleme oder gesundheitliche Störungen auf.
Der Mobbingforscher Heinz Leymann (Leymann 1992) sieht ein zentrales Merkmal für Mobbing darin, dass über längere Zeit hinweg systematische Vorgänge ablaufen mit dem Ziel, einen oder mehrere Menschen auszugrenzen. Der betroffene Mensch ist dabei den mobbenden Personen unterlegen und empfindet die Aktionen als diskriminierend.
Wie wird gemobbt?
Es gibt mehrere Ebenen, auf denen sich Schikane und Intrigen abspielen können:
- Verbale Ebene: Beschimpfungen, Verletzungen sowie abwertende Aussagen zu einer Person, über ihr Äußeres, ihre Kleidung oder ihre Verhaltensweisen. Dazu gehören auch falsche Aussagen über eine Person wie beispielsweise rufschädigendes Verhalten, Drohungen, Beleidigungen und erpresserisches Verhalten.
- Physische Ebene: Das Opfer wird körperlich angegriffen oder verletzt.
- Soziale Ebene: Die betreffende Person wird gemieden, ausgeschlossen und verliert ihre sozialen Beziehungen. Demütigende Handlungen wie etwa Streiche spielen, öffentliche Bloßstellungen, Intrigen spinnen sowie Leistungen herabwürdigen gehören dazu.
- Die Ebene der Cyberwelt: Das Opfer wird über soziale Medien im Internet beleidigt oder bedroht.
- Psychologische Ebene: Die betroffene Person wird durch anhaltende negative Verhaltensweisen emotional verletzt. Machtdemonstrationen gehören dazu, wie etwa Gesprächsverweigerung oder Ausgrenzung. Im beruflichen Bereich kommt es dazu, dass Arbeitsaufträge erschwert oder sabotiert werden.
Meist läuft ein sehr komplexer Prozess auf mehreren dieser Ebenen ab.
Ursachen: Opfer, Täter, Strukturen
Betroffene Personen äußern häufig die Frage: “Warum gerade ich?“
Die Schikane kann im Grunde jeden treffen. Ob jung oder alt, männlich oder weiblich, unabhängig von Bildungsgrad oder Herkunft, niemand ist immun. Es ist ein allgegenwärtiges Problem, das sich sowohl direkt zeigen, als auch indirekt wirken kann.

Welche Risikofaktoren fördern es, dass ein Mensch Mobbingopfer wird?
Es gibt einige Faktoren, die das Mobbingrisiko für bestimmte Personen erhöhen. Diese sind vor allem bei Kindern und Jugendlichen zu bemerken, jedoch beziehen sie sich auch auf Erwachsene.
- Persönliche Gründe: Menschen, die ein anderes Aussehen, eine andere kulturelle Herkunft oder eine Behinderung haben oder die aus sonstigen Gründen als “anders” wahrgenommen werden, tragen ein erhöhtes Risiko, Mobbingopfer zu werden.
- Emotionale Gründe: Wenn Menschen unsicher, ängstlich oder depressiv sind, tragen sie ein höheres Risiko, gemobbt zu werden. Menschen mit einer sehr ruhigen oder ausgeprägt empfindsamen Persönlichkeitsstruktur, über angepasste Personen mit geringer Konfliktfähigkeit und aggressive Persönlichkeiten mit geringer Anpassungsfähigkeit werden häufiger gemobbt.
- Soziale Gründe: Wer wenig Freunde hat oder sozial isoliert ist, wird wahrscheinlich schneller ein Opfer.
- Familiär bedingte Gründe: Kinder, die in der Herkunftsfamilie Missbrauch oder Gewalt erfahren haben, sind stärker gefährdet, Mobbingopfer zu werden.
Nicht alle Menschen, die bestimmte Risikofaktoren mitbringen, werden tatsächlich Opfer. Andererseits können Kinder, Jugendliche und Erwachsene ohne einen dieser Risikofaktoren trotzdem gemobbt werden.
Welche Risikofaktoren fördern es, dass ein Mensch andere mobbt und zum Täter wird?
Auch bei den Tätern gibt es Faktoren, die die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass das aggressive und ausgrenzende Verhalten ausgeübt wird:
- Mangelndes Selbstbewusstsein sowie Unsicherheit: Menschen, ob Kinder, Jugendliche oder Erwachsene, die andere mobben, sind oft selbst unsicher und steigern ihr Selbstwertgefühl durch die Demütigung und Ausgrenzung anderer.
- Manche der Täter streben nach Anerkennung im sozialen Gefüge.
- Selbst erlebte körperliche oder psychische Gewalt wird kompensiert, eigene Aggressionen werden an andern ausgelassen. Eigene Schwächen, Gefühle der Hilflosigkeit und Ängste werden von anderen abreagiert.
- Der Wunsch nach Macht und Kontrolle über andere kann ein intrigantes Verhalten hervorbringen.
- Konkurrenzdenken, Eifersucht sowie Neid sind häufige Ursachen.
Strukturelle Risikofaktoren
- Soziale Hierarchie: Eine starke Hierarchie in Firmen, Schulen, Institutionen sowie ein übergroßer Wettbewerb, um Anerkennung und Macht fördern das Mobbinggeschehen.
- Geschützte Umgebung: Wenn Kinder und Jugendliche keine Umgebung haben, die ihnen Sicherheit bietet, können Schikanen leichter entstehen.
- Fehlende Unterstützung: Wenn beispielsweise an einer Schule wenig Aufsicht und Unterstützung implementiert ist, besteht ein höheres Risiko, dass sich Mobbing entwickelt.
- Gesellschaftliche Normen: Wenn kulturelle sowie gesellschaftliche Werte und Normen Ausgrenzung und Machtgefälle dulden, können sie potenzielle Täter ermutigen.
Die Rolle derjenigen, die bewusst wegschauen
Wer bewusst wegschaut, wenn jemand gemobbt wird, fördert indirekt das aggressive Verhalten. Indem Beobachter nicht reagieren, erhält der Täter die Botschaft, sein Verhalten werde toleriert.
Das Opfer kann ein Nichteingreifen als Zeichen dafür sehen, dass es alleine gelassen wird. Es ist jedoch für Opfer kaum möglich, aus eigener Kraft dem destruktiven Prozess zu entrinnen. Daher ist es wichtig, dass alle Zeugen sich aktiv für die betroffene Person einsetzen.

Kurzfristige und langfristige Folgen von Mobbing
Wer gemobbt wird, trägt sowohl kurz- als auch langfristig an den Folgen. Jugendliche und Kinder, die eine Ausgrenzung in der Schule in Form von Schikane, gezielten Intrigen und Gewalt erfahren, leiden sehr stark. Panikattacken bei Kindern sind keine Seltenheit. Zudem haben sie oft ihr ganzes Leben lang daran zu tragen.
Häufig zeigen Mobbingopfer ihren Eltern sowie Lehrern nicht, dass sie leiden. Sie glauben oft nicht, dass ihnen jemand aus ihrer Lage helfen kann. Somit leiden sie innerlich umso mehr. Oft schaffen sie es erst, sich ihren Eltern oder einem Lehrer anzuvertrauen, wenn der Leidensdruck zu groß wird.
Die Auswirkungen der Gefühle von Ausgegrenztheit und Ohnmacht betreffen alle Lebensbereiche:
- Psychische Gesundheit: Angstzustände, niedrige Selbstachtung, Depressionen und Suizidgedanken, geringeres Selbstwertgefühl, Selbstbeschuldigungen
- Körperliche Beeinträchtigung: Kopfschmerzen und Schlafstörungen, Bauchschmerzen, Übelkeit, Albträume, Appetitlosigkeit, Ess-Störungen
- Soziale Beziehungen: soziale Isolation und Defizite beim Aufbau sozialer Beziehungen, in der Folge Isolations- sowie Einsamkeitsgefühle
- Verhaltensprobleme: Aggressivität und Racheakte
- Schulische Leistungen: Eine Verringerung der Schulleistungen und Angst vor dem Schulbesuch
- Verletztes Selbstwertgefühl sowie Selbstbeschuldigungen
- Isolation und Einsamkeitsgefühle
Nach einer Schätzung von Experten sind etwa 20% aller Suizide Folge eines Mobbinggeschehens.
Dan Olweus, ein schwedischer Psychologe, beschäftigte sich über viele Jahre mit dem Thema Gewalt und Mobbing in der Schule. Er fand durch eine Studie heraus, dass Kinder und Jugendliche, die in ihrer Schulzeit im Alter von 13-16 Jahren Mobbingerfahrungen hatten, in der Folge später weitaus häufiger an Depressionen und mangelndem Selbstwertgefühl litten.
Dadurch isolierten sie sich überdurchschnittlich stark von ihrem sozialen Umfeld. Durch das verlorene Vertrauen leben viele Schikane-Opfer auch als Erwachsene ein zurückgezogenes Leben.
Beispiel Folgen von Mobbing: Panikattacken bei Kindern
- Kinder, die gemobbt werden, können durch die andauernden Stress-, Spannungs- und Angsterfahrungen Panik entwickeln. Panikattacken können sich beispielsweise durch Körpersymptome wie Übelkeit, Atemnot, Schwitzen und Herzklopfen äußern.
- Betroffene Kinder brauchen professionelle Unterstützung, damit sie gestärkt werden. Eine Kombination aus Verhaltenstherapie sowie Psychotherapie kann sinnvoll sein. Die Fürsorglichkeit und Unterstützung von Eltern, Lehrern und anderen Bezugspersonen ist notwendig.
- Zur Unterstützung gehört auch, das schikanierende Verhalten an der Quelle zu bekämpfen, indem respektvolles und verantwortungsbewusstes Verhalten gefördert wird.
Weitere Auswirkungen von Mobbing
In manchen Fällen richten sich die Folgen der Schikanen nach außen. Dann tritt das Mobbingopfer aggressiv auf und entwickelt sich später selbst zum Täter. Vor allem, wenn Opfer die eigenen Erlebnisse sowie Belastungen nicht ausreichend verarbeiten konnten, finden sie in die Täterrolle.
Sie sehen keine andere Handlungsmöglichkeit, als andere Menschen zu behandeln, wie sie selbst es erfahren mussten.
Nicht jedes Mobbing Opfer reagiert gleich auf die Belastung
Die Spätfolgen durch Mobbing psychologisch betrachtet, lassen sich daran erkennen, wie Betroffene aktuell mit Stress umgehen und wie sie an diesen Erfahrungen langfristig körperlich und psychisch erkrankt sind.
Viele Opfer leiden noch ein Leben lang and den Folgen von Mobbingtaten in der Vergangeheit.
Es hängt von der Persönlichkeit jedes einzelnen Betroffenen ab, wie er mit seinen Erfahrungen umgeht. Manche Menschen leiden extrem stark unter derartigen Übergriffen, andere verfügen über ausreichend Resilienz und schaffen es vielleicht, sich von den Attacken abzugrenzen und sie zu verarbeiten.
Damit die Folgen gering ausfallen, sind Vertrauenspersonen von großer Bedeutung, um die Opfer zu verstehen und sie zu unterstützen.

Wenn Kinder betroffen sind – was können Sie tun?
Wenn Kinder oder Jugendliche Mobbingopfer sind, ist es wichtig, dass Sie als Lehrer oder als Eltern Kindern die Angst nehmen und Ihre Unterstützung anbieten:
- Spreche mit deinem Kind: Schaffe eine Atmosphäre des Vertrauens, in der das Kind offen mit dir sprechen kann. Thematisiere das Geschehen und helfe, seine Gedanken sowie Gefühle auszusprechen.
- Vermittle dem Kind deutlich, dass es immer Unterstützung erhalten kann und dass es nicht alleine ist. Baue ein Unterstützungsnetz auf.
- Informiere die Schulleitung oder andere Verantwortliche. Arbeite mit anderen Verantwortlichen zusammen, um den belastenden Prozess rasch zu beenden.
- Ziehe bei Bedarf Experten zurate. Ob Beraterin, Schulpsychologe, Vertrauenslehrerin oder Kindheitspädagoge, Fachleute können oft eine hilfreiche Partie übernehmen.
- Beobachte das Kind und schätze ein, wie es sich fühlt. Hole bei Bedarf professionelle Hilfe.
- Bestätige dem Kind, dass es selbst in Ordnung ist, dass Mobbingaktivitäten falsch sind und dass dieses Geschehen nicht toleriert wird.
- Vermittle dem Kind Kommunikationsfähigkeiten als Maßnahmen gegen Mobbing, damit es lernt, sich zu schützen. Schlagfertigkeitstrainings sind besonders geeignet, um Kindern und Jugendlichen zu helfen, sich aus der Ohnmacht zu befreien und den Tätern verbal entgegenzustehen.
- Stärke das Selbstwertgefühl des Kindes, indem du es positiv bestärkst. Ermutige dein Kind, Freundschaften sowie soziale Kontakte aufzubauen. Hier kann zum Beispiel offene Jugendarbeit einen wichtigen Beitrag leisten, um Kindern Übungsfelder zur Verfügung zu stellen.
Prävention durch Jugendcoaches
Mobbingerlebnisse im Kindes- und Jugendlichenalter können langanhaltende Schäden fürs weitere Leben verursachen. Die Einbindung von Jugendcoaches kann dazu beitragen, dass destruktive Prozesse früh erkannt und aufgelöst werden und dass in der Folge betroffene Kinder und Jugendliche Unterstützung für ihre Entwicklung erhalten.
Jugendcoaches bringen ihre Fähigkeiten und Methoden ein, um Konflikte zu lösen, Kommunikation anzuregen und Probleme zu lösen. Sie haben fundierte Kenntnisse und Erfahrung zum Thema und können die betroffenen Kinder und Jugendlichen unterstützen, ihre eigenen Stärken zu entwickeln.
Sie können als unvoreingenommene Partner ihre Rolle nutzen, um alle Beteiligten in einen konstruktiven Dialog zu führen, und sie tragen dazu bei, bei Tätern die Empathie für andere zu fördern.
Die Verarbeitung der Verletzung ermöglichen – und präventiv handeln
Mobbing kann schwere, belastende Auswirkungen auf die Opfer haben. Die Folgen können Angstzustände, Depressionen, ein geringes Selbstwertgefühl, gesundheitliche Probleme und sogar Suizidgedanken sein. Eine möglichst zeitnahe Verarbeitung der Geschehnisse ist geboten.
Doch es ist auch von großer Bedeutung, derartige Schikanen zu verhindern. Es geht darum, eine respektvolle und sichere Umgebung zu schaffen. Gerade Kinder und Jugendliche sollen sich entwickeln und entfalten können, ohne in ihrem Wachstum durch Aggressivität jeglicher Art gehindert zu werden.
Es geht darum, eine Atmosphäre zu entwickeln, in der Diskriminierung, Verletzungen sowie Gewalt keine Chance haben. Kinder und Jugendliche sollen in ihrem Wohlbefinden gestärkt werden. Mobbingprävention kann den Weg bereiten für ein gesundes und produktives Umfeld, in dem sich alle Menschen respektiert, wertgeschätzt und sicher fühlen.